|
Zu Gast in der Podcast-Reihe "Education Minds - Didaktische Reduktion» bei Yvo Wüest hat Sonja Gross über das Thema «Leichte Sprache» gesprochen. Warum ist es wichtig, dass wir uns in der Gesellschaft damit auseinandersetzen? Was unterscheidet Leichte Sprache von einfacher Sprache? Wer braucht Leichte Sprache, wer einfache Sprache? Welches sind die zentralen Regeln? Ausserdem erzählt Sonja Gross wie sie mit kritischen Rückmeldungen umgeht, welche Erfahrungen sie besonders berührt und welche Menschen sie am meisten inspiriert haben, sich in dieses Thema zu vertiefen. Yvo Wüst schreibt: «In unserem Gespräch wird mir schnell klar: Mehr "Leichte Sprache" hat viele Vorteile. Nicht nur für die Betroffenen, die vielleicht eine Einschränkung haben und so der Kommunikation bei Behörden, im Krankenhaus oder bei einer Weiterbildung leichter folgen können. Auch Unternehmen, Geschäftsleute oder Fachpersonen profitieren von den Prinzipien Leichter Sprache, zum Beispiel indem sie sie für eine sympathische und moderne Art der Kommunikation nutzen. Ausserdem kann zum Beispiel eine größere Zielgruppe für ein Bildungsangebot angesprochen werden, Therapieanweisungen werden besser verstanden oder Gesundheitskosten eingespart. Darüber hinaus kann Leichte(re) Sprache zu einer besseren Reputation einer Organisation führen.
0 Kommentare
Was ist Leichte(re) Sprache? Wie genau schreibt und spricht man leicht oder leichter? Dieses Buch gibt Antworten. Leichte Sprache ist eine besonders einfache Sprache mit kurzen Sätzen, alltagsnahen Wörtern, prägnanten Aussagen und verständlicher Darstellung. Studien zeigen, dass ca. ein Drittel der Erwachsenen im Alltag Mühe hat, schriftliche Informationen von Firmen, Behörden oder Medien zu verstehen. Mehr als die Hälfte der deutschen Bevölkerung hat Probleme, den Erklärungen von medizinischen und therapeutischen Fachpersonen zu folgen. Durch Leichte(re) Sprache werden gesundheitsrelevante Informationen besser verstanden und damit die Beziehungsqualität, die Patientensicherheit sowie der Therapieerfolg erhöht. Aber auch in anderen Bereichen wird Leichte(re) Sprache mit Erfolg eingesetzt, um mehr Menschen zu erreichen, Missverständnisse zu reduzieren und die Zusammenarbeit zu verbessern. Von Leichter(er) Sprache profitieren deshalb neben medizinischen und betreuerischen Fachpersonen auch Lehrpersonen, Eltern, Führungspersonen, Politikerinnen und Politiker, Behördenmitarbeitende, Angehörige von Demenzbetroffenen und viele weitere Berufsgruppen mit Kundenkontakt. Dieses Buch gibt einen Überblick über alles Wissenswerte über Leichte(re) Sprache: die Grundlagen, den Hintergrund sowie die Wirkweise. Außerdem erfahren die Leserinnen und Leser mehr über die bestehenden Regelwerke und lernen, wie sie die Regeln optimal für sich und ihre Ziele einsetzen können. Die Theorie wird mit kurzweiligen Beispielen vermittelt und die enthaltenen Übungen, Tipps und Checklisten bieten Unterstützung bei der eigenen Umsetzung.
Wer Leichte Sprache einführen möchte, wird sich früher oder später mit der Frage auseinandersetzen: „Welches Label ist das Richtige für uns?“ Ein Label hat verschiedene Zwecke. Auf der einen Seite dient es zur Kennzeichnung eines Textes in Leichter Sprache. So erkennt die Zielgruppe auf einen Blick, dass der Text leicht verständlich geschrieben ist und für Lesende von Standardsprache ist dadurch offensichtlich, warum der Text in leicht veränderter Form daherkommt. Andererseits ist ein Prüfsiegel ein Zeichen für die Qualität der Übersetzung. Leichte Sprache liegt im Trend. Wer ein möglichste breites Zielpublikum erreichen möchte, verfasst seine Texte in Leichter Sprache. Eingeführt wurde Leichte Sprache ursprünglich für Menschen mit einer kognitiven Beeinträchtigung. Inzwischen hat sich gezeigt, dass das Lesen von Texten in Leichter Sprache auch eine Hilfestellung darstellt für Menschen mit:
Wenn Sie noch mehr wissen möchten über Leichte Sprache, lesen Sie in meinem letzten Blogartikel: Der neue Trend: Leichte Sprache, die Sprache für alle. Immer mehr Behörden, Medien, soziale Institutionen und Vereine, aber auch Unternehmen folgen dem Trend und stellen ihre Informationen (zusätzlich) in Leichter Sprache zur Verfügung. Die allermeisten kennzeichnen diese Texte mit einem Label. Wer welches Label wählt, wird derzeit in der Schweiz noch sehr unterschiedlich gehandhabt. Grund dafür ist wohl auch, dass es je nach Label unterschiedliche Voraussetzungen zu erfüllen gilt, damit das jeweilige Label verwendet werden darf. In diesem Artikel habe ich die Labels mit den wichtigsten Unterschieden für Sie zusammengestellt.

Stiftung Universität Hildesheim Die Universität Hildesheim ist bekannt für ihre Forschungsarbeiten zu Leichter Sprache. Als einzige Universität verfügt sie über die Forschungsstelle Leichte Sprache, an der sowohl wissenschaftliche Arbeiten als auch praktische Projekte umgesetzt werden. Basierend auf Forschungsergebnissen hat sie ein umfangreiches Regelbuch herausgegeben, welches auch online zu finden ist. Die Forschungsstelle der Universität Hildesheim führt forschungsbegleitete Übersetzungsprojekte durch und bietet die Prüfung von bereits übersetzten Texten an. Von der Forschungsstelle geprüfte und entsprechend überarbeitete Texte erhalten das Label „Leichte Sprache wissenschaftlich geprüft“ und zusätzlich das Prüfsiegel für Leichte oder Einfache Sprache. Diese Siegel dürfen von allen genutzt werden, die Texte in Leichter Sprache produzieren und sind frei zugänglich. Voraussetzung zur Verwendung dieser Siegel ist, dass das Regelset der Forschungsstelle Leichte Sprache befolgt wird. Im Gegensatz zu den anderen hier aufgeführten Labels muss jedoch die Siegelverwendung nicht notwendigerweise auch an eine Zielgruppenprüfung gebunden sein.  Capito Capito ist ein privates Unternehmen mit dem gemeinnützigen Unternehmensziel die Gleichstellung und Teilhabe aller Menschen zu fördern. Capito hat ein breites Angebot, um Informationen verständlich zu machen. Dazu gehören Übersetzungen in Leichte Sprache, das Erstellen von Lernunterlagen sowie Workshops und die Analyse zur physischen Barrierefreiheit. Capito verwendet, je nach Sprachlevel, eines der folgenden drei Labels zur Auszeichnung geprüfter Texte: Um das Label verwenden zu dürfen, müssen Sie entweder Ihre Texte direkt von Capito übersetzen lassen oder eine Franchise-Partnerschaft mit Capito eingehen. „capito Qualitäts-Partner nutzen das capito Know-how und halten sich an den capito Qualitäts-Standard. Sie werden von einem autorisierten Social Franchise Partner in ihrer Nähe betreut, der ihnen für Tipps, Stichproben-Überprüfung und praktische Hilfestellung zur Verfügung steht.“ (capito, online). Netzwerk Leichte Sprache Beim Netzwerk Leichte Sprache handelt es sich um einen Verein mit Mitgliedern aus Deutschland, Österreich, Südtirol, der Schweiz und Luxemburg. Das Netzwerk wurde 2006 von Menschen mit und ohne Behinderung gegründet. In dem Netzwerk arbeiten unter anderem Übersetzer*innen und Prüfer*innen und andere Personen, die mit Leichter Sprache arbeiten zusammen mit dem Ziel, sich zu vernetzen, weiterzubilden und Leichte Sprache weiterzuentwickeln. Auch die Regeln werden stetig ergänzt und neu angepasst. Das aktuelle Regelbuch ist online abrufbar. Genutzt werden darf das Label von allen Netzwerk-Mitgliedern. Diese bezahlen einen jährlichen Mitgliedsbeitrag und verpflichten sich zur Verwendung des Regelwerkes.  Bund, Schweizerisches Department des Inneren Spannend ist auch immer zu sehen, für welches Label sich der Bund entschieden hat. In diesem Fall hat er keines der bestehenden Labels gewählt; stattdessen hat das Gleichstellungsbüro vom Eidgenössischen Departement des Inneren eigene Kennzeichnungen entwickelt. Die Überlegung dahinter, so hiess es auf Anfrage, ist es, einen einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen. Dies wäre, da viele verschiedene Labels bzw. Kennzeichnungen gebraucht würden, zum Beispiel für Gebärden, für barrierefreie PDF-Texte oder für Audio-Unterstützung, ansonsten nicht gegeben. Die Labels dürfen frei verwendet werden, hiess es auf Anfrage. Fazit Einige Labels sind frei verwendbar und an eine Selbstverpflichtung gebunden, andere setzen eine Mitgliedschaft oder eine Franchise-Partnerschaft voraus. Obwohl fast allen Labels eigene Übersetzungsregeln zugrunde liegen, sind die Unterschiede der Regelwerke aus meiner Sicht nur wenig erheblich. Weil diese Disziplin noch sehr jung ist, ist ausserdem davon auszugehen, dass sich die verschiedenen Labels in den kommenden Jahren noch öfters ändern und weiterentwickeln werden. Deshalb bin ich der Meinung, dass von Einzelfall zu Einzelfall geprüft werden sollte und im Zweifelsfall entsprechend der Rückmeldungen der Zielgruppe übersetzt werden sollte. Dennoch spreche ich mich ganz klar dafür aus, Texte einheitlich mit einem Label zu kennzeichnen und damit gewisse Qualitätsstandards einzuhalten, um zum einen Texte in Leichter Sprache in Zukunft vor allem für die Zielgruppe leicht erkennbar zu machen, zum anderen aber auch in der Hoffnung, dass durch die vermehrte Sichtbarkeit noch mehr Unternehmen auf diesen (wichtigen) Zug aufspringen.
An der I/O Entwicklerkonferenz anfangs Mai stellt Google drei neue innovative Projekte vor, die Menschen mit einer Behinderung dabei helfen ein selbstbestimmteres Leben zu führen. Die Projekte heissen:
Emil Protalinski beschreibt die drei Projekte auf venturebeat.com wie folgt: Projekt Euphonia Das Projekt Euphonia, das sich in einem frühen Forschungsstadium befindet, zielt darauf ab, Menschen mit Sprachbehinderungen eine einfachere Kommunikation zu ermöglichen. Sprachstörungen können durch Entwicklungsstörungen wie Zerebralparese und Autismus oder neurologische Erkrankungen wie Schlaganfall, ALS (Amyotrophe Lateralsklerose), MS (Multiple Sklerose) oder beispielsweise durch traumatische Hirnverletzungen und Parkinson verursacht werden. Mit dem Projekt Euphonia will Google die Fähigkeit des Computers so verbessern, dass er Menschen mit Sprachstörungen versteht. Der Computer übersetzt dann ihre Aussagen, so dass sie für alle verständlich sind. Die Anwendungsmöglichkeiten sind im Moment noch begrenzt. Das Programm funktioniert nur für Personen, die Englisch sprechen und Beeinträchtigungen haben, die typischerweise mit ALS verbunden sind. Google ist jedoch zuversichtlich, dass die Studie später auf größere Personengruppen und verschiedene Sprachstörungen angewendet werden kann. Im Video sehen Sie den Google-Sprachforscher Dimitri Kanevsky, der Englisch lernte, nachdem er als kleines Kind in Russland taub geworden war, und Steve Saling, bei dem vor 13 Jahren ALS diagnostiziert wurde. Kanevsky verwendet „Live Transcribe“ mit einem benutzerdefinierten Modell, das speziell darauf trainiert ist, seine Stimme zu erkennen. Saling verwendet „Non-Speech-Sounds“, um Smart-Home-Geräte anzusteuern und Gesichtsbewegungen, um bei einem Sportspiel mit zu fiebern. Live Relay Menschen, die taub oder schwerhörig sind, kommunizieren häufig über Gebärdensprache oder Chat. Aber was ist, wenn sie die Person, mit der sie sprechen, nicht sehen können und keine SMS verfügbar sind? Sprachanrufe sind keine Option. Bis der Google-Softwareentwickler Sapir Caduri feststellt, dass sie es doch sind! „Live Relay“ verwendet die Spracherkennung und die Sprachausgabe auf dem Gerät, damit Ihr Telefon in Ihrem Namen zuhören und sprechen kann. Das Forschungsprojekt ermöglicht es einer sprechenden Person, eine gehörlose oder schwerhörige Person anzurufen. Das Tool wandelt Sprache in Echtzeit in Text um und sendet geschriebene Nachrichten als gesprochene Stimme zurück. Die Person, die spricht, kann einfach am Telefon sprechen, und die Person, die taub oder schwerhörig ist, kann eine SMS an ihr Telefon senden. Live Relay nutzt auch die Funktionen "Smart Compose" und "Smart Reply" von Google. Vorausschauende Schreibvorschläge und sofortige Antworten helfen der tippenden Person, mit der Geschwindigkeit eines Sprachanrufs Schritt zu halten. Wichtig ist, dass Live Relay vollständig auf Ihrem Gerät ausgeführt wird, sodass Ihre privaten Anrufe nicht an Google gesendet werden. Das Tool benötigt keine Datenverbindung (nur Mobilfunk) und verwendet nur Audio. Das bedeutet, dass Live Relay mit jedem eingehenden Sprachanruf von jedem Telefon, einschliesslich Festnetz, funktioniert. Google betrachtet Live Relay als Alternative zu Real-Time-Text (RTT) und Relay Services. Live Relay könnte für alle Benutzer*innen nützlich sein. Haben Sie schon einmal einen wichtigen Anruf erhalten, können aber nicht aussteigen und sprechen? Mit Live Relay können Sie diesen Anruf entgegennehmen, indem Sie eingeben, anstatt zu sprechen. Google plant sogar, Echtzeit-Übersetzungen in Live Relay zu integrieren, um weitere Kommunikationsbarrieren abzubauen. Damit wäre es möglich jeden auf der Welt anzurufen und zu kommunizieren, unabhängig davon, welche Sprache er oder sie spricht. Die sprechende Person spricht in ihrer bevorzugten Sprache und der Text erscheint in der Sprache des Empfängers und umgekehrt. Projekt DIVA Projekt Diva, das für DIVersely Assisted steht, unterstützt Benutzer*innen bei der Eingabe der Google Assistant-Befehle, ohne ihre Stimme zu verwenden. Eine Person mit nonverbaler oder eingeschränkter Mobilität kann mithilfe eines externen Gerätes Google Assistant-Befehle auslösen. Das Team untersuchte verschiedene Auslösebefehle. Darunter das Drücken eines grossen Knopfes mit Kinn, Fuss oder sogar einem Biss. Nach monatelangem Brainstorming und Präsentationen in verschiedenen Bereichen der Barrierefreiheit und Technik baute das Team einen Prototyp und gewann einen Innovationswettbewerb für Barrierefreiheit. Die Lösung war eine Box, in die Sie einen Hilfsknopf über eine 3,5-mm-Buchse einsteckten. Das von der Schaltfläche ausgehende Signal wird dann in einen Befehl umgewandelt, der an den Google-Assistenten gesendet wird. Mit dem Hilfsknopf ist es nun möglich beispielsweise Musik auf herkömmlichen Geräten abzuspielen, ohne diese direkt bedienen zu müssen. So, wie es Giovanni, der Bruder des Entwicklers dieses Knopfes macht im Video: In Zukunft soll es mit dieser Technologie auch möglich sein weitere Objekte mit Tags zu versehen und jedem Tag einen Befehl zuzuweisen. Damit wird es beispielsweise möglich mittels einer Cartoon-Puppe einen Cartoon im Fernsehen einzuschalten oder durch eine physische CD Musik auf Ihrem Lautsprecher auszulösen. Google gibt Entwickler*innen alle technischen Details bekannt, damit sie ihr eigenes Project Diva-Gerät erstellen können! Ich hatte Gänsehaut beim Lesen dieser tollen Neuigkeiten und freue mich auf die weiteren Entwicklungen. Ich hoffe, es geht Ihnen genau so. Literatur und Links Protalinski, Emil (7.5.2019): Google unveils 3 accessibility projects that help people with disabilities online: https://venturebeat.com/2019/05/07/google-ai-accessibility-project-euphonia-diva-live-relay/
UK - ein Leben lang Unter diesem Motto stand das diesjährige UK-Symposium an der Fachhochschule Nordwestschweiz. Denn: «Um die kommunikative Situation von Menschen, die in ihrer Laut- und/oder Schriftsprache beeinträchtigt sind, zu verbessern, braucht es ein lebenslanges Engagement von allen.» (FHNW, online). Viele Fachpersonen kamen an diesem Tag in Olten zusammen, um neue Erkenntnisse vorzustellen und sich auszutauschen. Besonders beschäftigt haben mich die Fragen: Was hat sich im Bereich der UK verändert? Was sind Gelingensbedingungen zur Umsetzung von UK? Gerne möchte ich meine Erkenntnisse hier mit Ihnen teilen. UK steht für Unterstützte Kommunikation
UK steht für Unterstützte Kommunikation und hat zum Ziel, allen Menschen mit unterschiedlichen Voraussetzungen Kommunikation zu erleichtern. UK ist die deutsche Bezeichnung für das internationale Fachgebiet „Augmentative and Alternative Communication (AAC)“. Übersetzt bedeutet der englische Fachausdruck „ergänzende und ersetzende Kommunikation“. Damit sind alle pädagogischen oder therapeutischen Massnahmen gemeint, die fehlende Lautsprache ergänzen oder ersetzen, um die kommunikativen Möglichkeiten zu erweitern. Die Massnahmen reichen von einfachen Gesten, Bildern, grafischen Symbolen, Gebärden bis hin zu technischen Kommunikationshilfen mit künstlicher Sprachausgabe. Die Wichtigkeit von UK wächst – gefordert sind die Geschäftsleitungen Mit ca. 300 Teilnehmenden war das UK-Symposium restlos ausgebucht. Das ist ein Hinweis auf das grosse Interesse und die wachsende Wichtigkeit von UK. Gabriela Antener, Professorin an der Hochschule für Soziale Arbeit FHNW in Olten, erklärt im Einstiegsreferat, dass die Zahl der Menschen, die UK brauchen, in den letzten 20 bis 30 Jahren angestiegen ist. Dies aus drei Gründen: Erstens durch die bessere medizinische Versorgung, zweites durch die gestiegene Lebenserwartung und drittens, weil der Nutzen von UK für breitere Gruppen erkannt worden ist. Tatsächlich ist die Zielgruppe von UK sehr heterogen in Bezug auf das Alter und die Lebenssituation, Zeitpunkt und Dauer der Kommunikationsbeeinträchtigung sowie die Fähigkeiten und Beeinträchtigungen. Beispielsweise kann UK bei Kindern oder Erwachsenen eingesetzt werden, die mit einer geistigen Behinderung auf die Welt gekommen sind und die Sprache von Grund auf am Lernen sind. Aber auch Menschen mit Demenz, deren aktiver Wortschatz sich reduziert hat, oder Menschen mit Aphasie nach einer Hirnverletzung profitieren von den Methoden und Hilfsmitteln der UK. Dorothea Lage, ebenfalls Professorin an der Fachhochschule Nordwestschweiz und auch bekannt als «Miss UK» beobachtet, dass UK immer mehr ein Managementthema ist. Organisationen beschäftigen sich immer mehr mit der Frage, wie UK sinnvoll und längerfristig integriert werden kann. Denn viele Kantone haben in ihren Gesetzen zur Betreuung das Thema «Teilhabe» und die Orientierung an der BRK drin, was UK automatisch zu einer Verpflichtung macht. In erster Linie sind in den Organisationen die Geschäftsleitungen für die Einführung und Etablierung von UK in ihrer Institution verantwortlich. Deswegen sagt Dorothea Lage: UK ist Chefsache! Und betont, es sei an der Zeit, dass Chefs aktiv werden, denn noch immer haben viele Menschen keinen Zugang zu UK. Die BSV-Studie zeigt: UK-Zuständige in den Institutionen haben zu wenig Ressourcen und Kompetenzen Das BSV (Bundesamt für Sozialversicherungen) hat 2016 eine Studie zum Thema UK veröffentlicht, in der es darum ging, die Abgabe von Kommunikationsgeräten an Versicherte der Invalidenversicherung zu untersuchen. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Kommunikationsgeräte wichtig sind, um den Betroffenen die Teilhabe in der Gesellschaft zu ermöglichen. Allerdings zeigte sich auch, dass die Nutzung der Geräte nach Austritt aus der Sonderschule tendenziell abnimmt. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Unterstützung in den Erwachseneninstitutionen aufgrund knapperer Ressourcen und weniger geschultem Personal schwächer ist und dies dazu führt, dass Betroffene weniger Unterstützung bei der Nutzung ihres Kommunikationsgerätes erhalten. Die Zuständigkeit für UK ist in den Institutionen sehr unterschiedlich organisiert. In fast der Hälfte der befragten Institutionen sind eine oder mehrere Personen im Betrieb offiziell für die UK zuständig (40%). Bei den meisten ist die Zuständigkeit breiter verteilt und wird jeweils fallbezogen, beispielsweise durch die Bezugsperson, für die einzelnen Klienten/Klientinnen wahrgenommen (55%). In einigen der befragten Institutionen gibt es zudem eine Arbeitsgruppe oder ein ähnliches Austauschgefäss (35%) und wenige Institutionen (ca. 10%) verfügen über eine UK-Fachstelle. Bei der Abgabe von Kommunikationsgeräten spielen die UK-Zuständigen der Institutionen eine wichtige Rolle. Zum einen können sie gewährleisten, dass das richtige Kommunikationsgerät abgegeben wird, weil sie den Betroffenen gut kennen. Zum anderen können sie die Nachhaltigkeit des Gebrauchstrainings sicherstellen bzw. die Versicherten nachhaltig bei der Verwendung der Kommunikationsgeräte unterstützen. Problematisch ist, dass viele UK-Zuständige im Interview angeben, dass sie nicht über die notwendigen Ressourcen verfügen, um sich stärker engagieren zu können. Nur etwas mehr als die Hälfte gibt an, die technischen Geräte selber bedienen zu können und weniger als die Hälfte traut sich ein Gebrauchstraining zu. Um Abklärungen vorzunehmen, fehlt es den meisten UK-Zuständigen an Kenntnissen zu den aktuellen Entwicklungen (vgl. Bundesamt für Sozialversicherungen, BSV, 2016, S. 49-54). Für die erfolgreiche Umsetzung braucht es das Engagement von allen: Modelling Monika Waigand erklärte im Einstiegsreferat, wie Kinder normalerweise Sprache erwerben: Babys hören ständig und überall Wörter. Die Eltern sprechen mit ihm, das Kind hört unterwegs andere sprechen, es hört Sprache im Radio und im Fernseher usw. Es hört so ca. 4‘000 Wörter täglich. Die Sprache wird nicht gezielt beigebracht, sondern entwickelt sich beim täglichen Kommunizieren miteinander automatisch. In der Regel ist dies ganz anders bei einem Kind, das keine Lautsprache kann und UK unterstützt wird. In Förderstunden wird dem Kind beigebracht, wie es kommunizieren könnte. Ausserhalb der Förderstunden spricht die Umwelt aber eine andere Sprache – die Lautsprache. Was wäre, wenn dem Kind mit UK pro Tag 4‘000 Bilder gezeigt würden und alle in seinem Umfeld mit UK kommunizieren würden? Frau Waigand fordert die gleichen förderlichen Rahmenbedingungen für Kinder mit UK wie für Kinder, die lautsprachlich aufwachsen und lernen. Das Stichwort hierzu heisst: Modelling. Modelling bedeutet, dass Bezugspersonen eine Kommunikationshilfe ebenfalls mitbenutzen. Sie werden damit zum Vorbild bzw. Modell für den Nutzer oder die Nutzerin. Wesentliche Prinzipien des Modelling sind nach Frau Waigand: Der Einsatz erfolgt ohne Voraussetzungen des UK-Nutzenden: Dieser muss die Symbole oder Begriffe weder verstanden haben noch dem Kommunikationspartner/der -partnerin aufmerksam folgen. Die Kommunikation mit dem Hilfsmittel erfolgt nicht in künstlich arrangierten Settings, sondern im Alltag. Kommunikation mit dem Hilfsmittel findet so immer und überall statt. Schlussfolgerung: Die Zukunft von UK in den Institutionen UK gewinnt an Bedeutung. Einerseits durch die fortschreitende Technik und die neuen Möglichkeiten, die sich daraus ergeben. Andererseits aber auch, weil die Zielgruppe zugenommen hat und noch mehr zunimmt: Dies dadurch, dass es tatsächlich mehr Menschen gibt, deren Lautsprache beeinträchtigt ist, aber auch, weil immer mehr erkannt wird, dass UK für eine sehr grosse und unterschiedliche Gruppe von Menschen eingesetzt werden kann. Nicht zuletzt aber auch durch die jüngsten Gesetze, die Teilhabe fordern und vor dem Hintergrund der unterzeichneten Behindertenrechtskonvention. Gefordert ist nun in erster Linie das Engagement der Geschäftsleitungen, die verantwortlich sind, dass UK in ihrer Institution eingeführt und etabliert wird und sie die dafür nötigen Ressourcen zur Verfügung stellen. Gefragt sind nicht nur Geschäftsleitungen von Institutionen für Menschen mit Behinderungen, sondern auch von Altersheimen. Bei der Etablierung ist das Erstellen eines UK-Konzeptes und darin auch die Festlegung der UK-Verantwortlichen und der dafür vorgesehenen Ressourcen ein wichtiger Schritt. Grossgruppenmethoden, sog. Konferenzen, in denen ein gemeinsames Anliegen gefunden und eine gemeinsame Basis geschaffen wird, können dabei hilfreich sein. Wie die BSV-Studie gezeigt hat, ist es für den erfolgreichen Einsatz der UK-Hilfsmittel von grosser Bedeutung, dass die UK-Verantwortlichen darin in Zukunft noch besser geschult werden. Darüber hinaus sollten aber auch alle weiteren Mitarbeitenden der gesamten Institution und soweit möglich des weiteren sozialen Umfeldes im Umgang mit den UK-Hilfsmitteln geschult werden, damit alle die UK-Sprache sprechen können. Nur so kann der Nutzende auch tatsächlich Fortschritte in seinen kommunikativen Fähigkeiten machen. Ausserdem ist eine sorgfältige Absprache mit der vorhergehenden Institution bedeutsam, da sich gezeigt hat, dass beim Übertritt von der Sonderschule in eine Einrichtung für Erwachsene die Nutzung von UK oftmals abnimmt. So kann UK zur Teilhabe an der Gesellschaft und zur Selbstbestimmung genutzt werden, und zwar ein Leben lang! Literatur und Links: Active Communication AG: UK-Symposium 2018. Online: http://www.uk-symposium.ch/pages/beitraege-2018.php (letzter Zugriff: 16.9.2018) Claudio Castañeda und Monika Waigand (2016): Ein Weg für jeden?! Modelling in der Unterstützten Kommunikation. Online: http://www.ukcouch.de/wp-content/uploads/2016/09/ModellingCastanedaWaigandk.pdf (letzter Zugriff: 16.9.2018) Bundesamt für Sozialversicherungen BSV: Analyse der Abgabe von Kommunikationsgeräten an Versicherte der Invalidenversicherung. Online: https://www.bsvlive.admin.ch/praxis/forschung/publikationen/index.html?lang=de&lnr=13/16&iframe_style=yes#pubdb (letzter Zugriff: 16.9.2018) Dorothea Lage und Solveig Steiger (2018): Gelingensbedingungen für die nachhaltige Verankerung von UK in Organisationen der Behindertenhilfe. Online: https://www.brühlgut.ch/wohnen-arbeiten/unterstuetzende-angebote/unterstuetzte-kommunikation (letzter Zugriff: 16.9.2018) |
Sonja Gross Master of Arts in Erziehungswissenschaft
Sie brauchen ein neues Institutionskonzept, Begleitkonzept oder möchten Ihre Angebotsbeschreibungen und Arbeitsanweisungen überarbeiten?
Oder Informationen in Leichter(er) Sprache? Holen Sie sich massgeschneiderte, professionelle Unterstützung und entspannen Sie! DO 26.9.2024:
Infoveranstaltung Leichte Sprache: Wissensdatenbank und E-Learnings 12:00 - 12:30 Uhr online Bleib auf dem Laufendem mit dem Newsletter:
Themen
Alle
Archiv
Juli 2024
|
|
Netzwerkpartnerin von
|
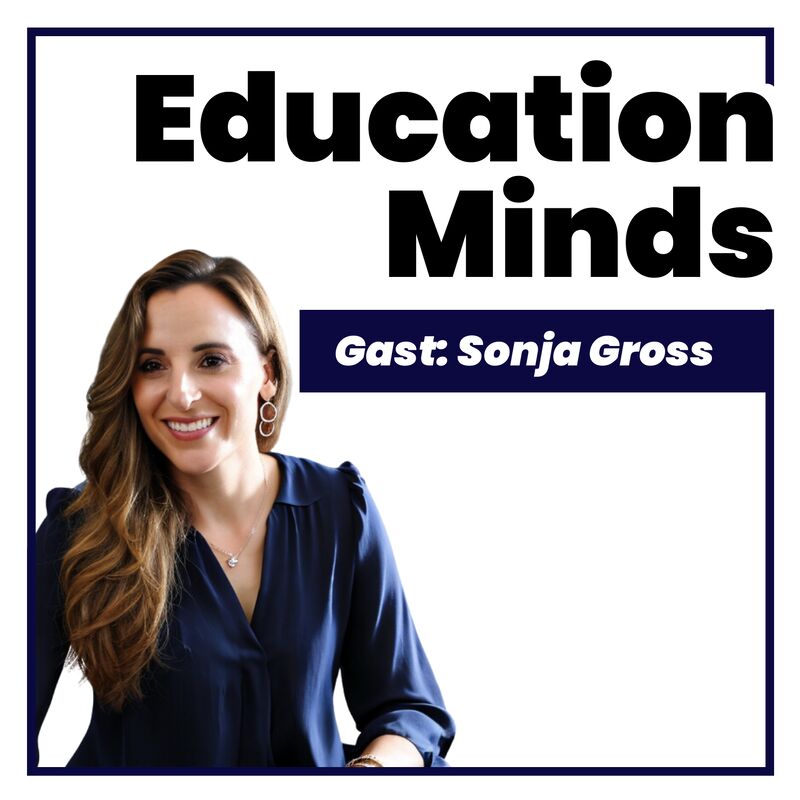














 RSS-Feed
RSS-Feed

